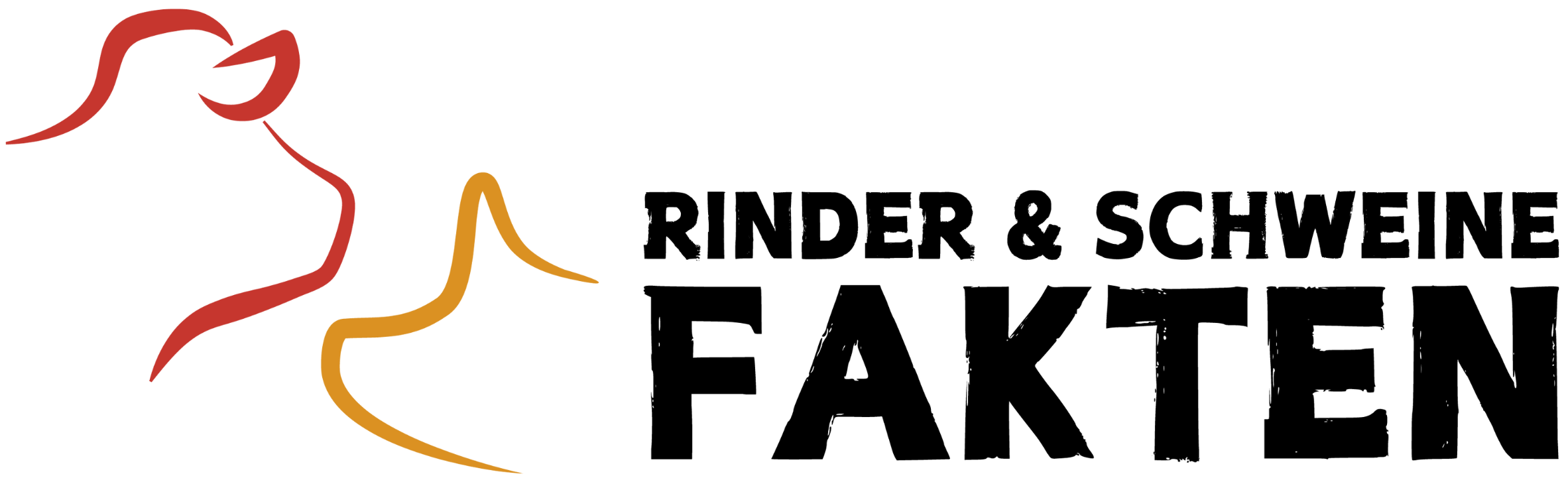BRS News
Neue GAP: Förderung gut angenommen, Zurückhaltung bei Ökoregelungen
Die jetzt vorliegenden Daten aus den Bundesländern zeigen: Im ersten Jahr der neuen Förderperiode der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) haben die Landwirtinnen und Landwirte Zahlungen in ähnlicher Höhe beantragt wie in den Vorjahren. Zurückhaltender als erwartet fiel das Interesse an den sogenannten EcoSchemes (Ökoregelungen
), aus. Zu den Ökoregelungen, mit welchen die Höfe für Umweltleistungen honoriert werden, zählen beispielsweise Blühstreifen auf Ackerland oder in Dauerkulturen, der Anbau vielfältiger Kulturen, Agroforst oder die Bewirtschaftung ohne Pestizide.
Gelungener Auftakt der Milchwoche 2023 im Kreis Höxter
Der bekannte Fernsehkoch Björn Freitag sorgte am 1. Juni 2023, dem Internationalen Tag der Milch, auf der Landesgartenschau Höxter, mit seiner kulinarischen Kunst für einen gelungenen Auftakt der Milchwoche 2023. Die Kochshow fand im Rahmen der Milchwoche 2023 statt. Das Ziel der Milchwoche ist es, die Bedeutung von Milch im Rahmen einer gesunden und nachhaltigen Ernährung, und die gesellschaftliche Akzeptanz für die Milcherzeugung zu stärken. Initiator ist die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW in Kooperation mit dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband und dem Westfälisch-Lippischen LandFrauenverband. Unterstützt wird sie vom NRW-Landwirtschaftsministerium.
Nitratrichtlinie: Vertragsverletzungsverfahren eingestellt - Kommentar von Backhaus
Der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Till Backhaus, äußerte sich zu der Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland bezüglich der Umsetzung der Nitratrichtlinie durch die EU-KOM. Nach Auffassung der Kommission entsprechen die vom Bund und den Ländern getroffenen Maßnahmen nun den EU-Vorgaben und sind geeignet, die Nitratbelastung der Gewässer anzugehen. Die drohenden Strafzahlungen wären im Falle einer Verurteilung Deutschlands im Zweitverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof mit der Festsetzung der Zahlung eines Pauschalbetrags von mindestens 17,2 Mio. € und einem täglichen Zwangsgeld in Höhe von bis zu 1,1 Mio. € ganz erheblich gewesen. Damit ist festzuhalten, dass auch MV seine Hausaufgaben gemacht hat, indem es eine Düngeverordnung auf den Weg gebracht hat, die dem Schutz unseres wichtigsten Lebensmittels Wasser und den Ansprüchen der EU-Kommission genügt. Jetzt geht es darum, mit den Landwirten gemeinsam daran zu arbeiten, dass in Zukunft weniger Nitrat in die Böden und damit ins Grundwasser gelangt
, so der Umweltminister.
DBV zur Einstellung des EU-Vertragsverletzungsverfahrens zur EU-Nitratrichtlinie
Die Entscheidung der EU-Kommission zur Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland wegen der EU-Nitratrichtlinie bewertet der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, als längst überfällig. Nun sei es möglich, wieder zu geordneten rechtsstaatlichen Verfahren im Düngerecht zurückzukehren, weil die EU-Kommission nicht mehr auf Zuruf Änderungen in der Düngeverordnung durchdrücken könne. Umso mehr bliebe es dringend erforderlich, einzelbetriebliche und verursachergerechte Klauseln für gewässerschonend wirtschaftende Landwirte statt Pauschalauflagen in roten Gebieten einzuführen. Auch solle die Derogationsregelung für Wirtschaftsdünger bzw. Gärrest wie bereits in der Düngeverordnung vorgesehen ermöglicht und hierfür der Antrag bei der EU-Kommission gestellt werden. Die Ampelkoalition müsse jetzt den aktuellen Regierungsentwurf des Düngegesetzes kritisch prüfen und anpassen, vor allem bei der flächendeckenden Einführung der Stoffstrombilanz sowie einzelbetrieblichen Ausnahmen für Landwirte in roten Gebieten.
EU-Nitratrichtlinie: Vertragsverletzungsverfahren eingestellt – hohe Strafzahlungen abgewendet
Heute hat die EU-Kommission das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen Nicht-Einhaltung der EU-Nitratrichtlinie eingestellt. Damit sind auch die drohenden, sehr hohen Strafzahlungen vom Tisch.
DBV: Umweltministerium spielt auf Zeit bei Bestandsregulierung von Wölfen
Anlässlich der Auftaktveranstaltung des Bundesumweltministeriums am 1. Juni 2023 zur Dialogreihe Wolf
drängen die Landnutzer- und Weidetierhalterverbände im Rahmen einer Pressekonferenz zu einer Änderung der Wolfspolitik. Die Dialogreihe Wolf
ist Teil des Koalitionsvertrages, in welchem ein institutionalisierter Dialog
zum Thema Wolf vorgesehen ist.
Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, fordert: Die Bestände der Wölfe haben sich in Deutschland exponentiell entwickelt, die Schäden in der Weidetierhaltung sind nicht mehr hinnehmbar und die Bundesregierung verschleppt die Probleme mit dem Wolf und einen notwendigen Einstieg in die Regulierung des Wolfsbestandes. Der Auftrag des Koalitionsvertrages zur Einführung eines regional differenzierten Bestandsmanagements darf nicht vom BMUV auf die lange Bank geschoben und wertvolle Zeit mit Debatten über das Monitoring verloren werden. Die Halter von Schafen, Ziegen, Rindern, Pferden und landwirtschaftlichen Wildtieren haben keine Zeit mehr, die Weidetierhaltung droht ein Opfer der Wolfspolitik des BMUV zu werden.
Dialogreihe Wolf gestartet - Auftaktveranstaltung mit Verbänden und Bundesländern
Das Bundesumweltministerium hat heute in Kooperation mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium die Dialogreihe Wolf
gestartet. Hauptziele der Veranstaltungsreihe: Der Austausch zu wichtigen Aspekten zum Wolf und die Versachlichung der Diskussion. Bei der Auftaktveranstaltung befassten sich die rund 70 Teilnehmenden aus Ministerien und Behörden, von Naturschutz- und Nutzerverbänden, aus der Wissenschaft sowie aus den Bundesländern insbesondere mit dem Monitoring, der Erfassung und der Entwicklung der Wolfspopulation. Weitere Veranstaltungen mit verschiedenen Schwerpunkten wie zum Herdenschutz sowie zum Umgang mit problematischen Wölfen werden folgen.
Podcast „Kommt der Wolf, geht die Weide“
In dem vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband e.V. zur Verfügung angebotenen Podcast von wirlandwirten.de geht es um den bekannten Slogan: Kommt der Wolf, geht die Weide
. Er wird oft im Zusammenhang mit der Debatte um den Wolf in Deutschland verwendet . Doch wie wirkt sich dieser Spruch auf die Meinungen und Einstellungen der Menschen aus? Dieser Frage gehen Tasmin und Paddy auf den Grund und lassen dabei auch unsere Hörerer:innen in kurzen Sprachnachrichten zu Wort kommen.
Tag der Milch - Überraschendes rund um die Milch

Eine ausgewogene, klimagerechte Ernährung wird für viele Verbraucher:innen immer wichtiger. Genießen ja, aber achtsam und ressourcenschonend. In diesem Speiseplan der Zukunft hat auch Milch ihren Platz. Wie die moderne Milchwirtschaft den Weg in eine nachhaltige Zukunft mitgestaltet, zeigen die Milch-Fakten der Initiative Milch.
Warum sind Milchkühe für eine grüne Zukunft unerlässlich? Wieso sind Kühe die größten Food-Waste-Gegnerinnen? Und wie geht Kimchi für Kühe? Diese Fragen sind die Blickfänger auf den diesjährigen Mediamotiven, gestaltet im Reportage-Stil. Die Antworten dazu finden sich u. a. in den aktuellen Podcast-Folgen #15 und #16 der in 2022 gestarteten Serie Let’s talk Milch, die über einen in den Mediamotiven eingebetteten QR-Code verlinkt sind.
BLE-Fachtag zum Umbau der Tierhaltung
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) diskutierte auf einem Fachtag am 31. Mai in Bonn mit Akteuren aus Politik, Wissenschaft und Praxis zu den Faktoren, die bei einer Transformation der Tierhaltung relevant wären. Tierhaltung muss anders werden. Dazu haben wir erstens eine transparente Haltungskennzeichnung vorgelegt, zweitens ein Bundesprogramm Tierhaltung entwickelt
, erklärte Silvia Bender, Staatssekretärin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Die BLE habe sich in der Vergangenheit als wichtiger und beratender Partner für das BMEL bewiesen und werde bei der Umsetzung der Tierwohl-Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen.